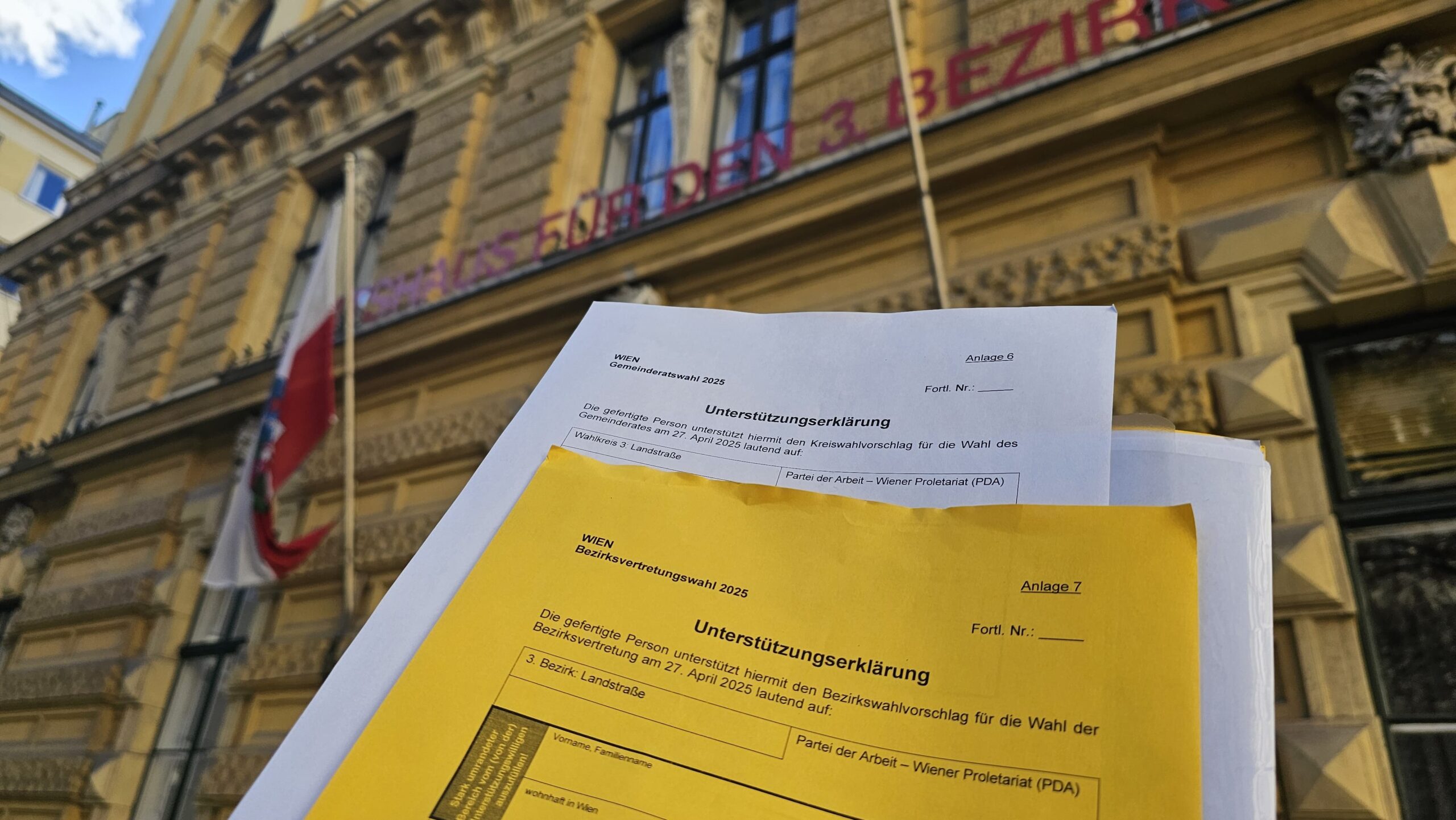Der nachfolgende Text wurde im März 2015 als Beitrag für die Programmdebatte verfasst. Manche Daten und auch Fakten sind nicht mehr auf dem neusten Stand, dennoch bleibt der Text in seinen Grundzügen aktuell.
Der nachfolgende Text wurde im März 2015 als Beitrag für die Programmdebatte verfasst. Manche Daten und auch Fakten sind nicht mehr auf dem neusten Stand, dennoch bleibt der Text in seinen Grundzügen aktuell.
Die gegenwärtige Krise kann als Regulierungskrise des Kapitalismus verstanden werden. Es ist zu solchen Disproportionen in der Volkswirtschaft gekommen, sowie zu einer massiven Überakkumulation an Kapital, dass diese im Rahmen einer gewöhnlichen zyklischen Krise nicht überwunden werden können. Dafür, dass wir es gegenwärtig mit einer Regulierungskrise des Kapitalismus zu tun haben, spricht, dass nicht nur die Struktur des Reproduktions- und Verwertungsprozesses in die Krise geraten ist, sondern auch, dass die Funktionsfähigkeit des bisherigen Regulierungsmechanismus versagt hat. Der Regulierungsmechanismus blockierte Ausgleichsprozesse im Reproduktionsprozess. Dies bezieht sich im Kern auf die kapitalistischen Zentren, wenngleich die Krise von globaler Dimension ist und auch die „Schwellenländer“, sowie die ärmsten „Entwicklungsländer“ von der Krise betroffen waren. Allerdings konnten die „Schwellen- und Entwicklungsländer“ des Südens die Auswirkungen der Krise begrenzen und kehrten alsbald annähernd zum alten Wachstumspfad zurück, während die entwickleten kapitalistischen Ländern bis heute an den Folgen der Krise laborieren, die insbesondere auch in den Ländern der Europäischen Union alles andere als ausgestanden ist.
Unter Regulierung verstehen wir die Regelung der Gesamtheit der Produktions- und Austauschbeziehungen. Sie betrifft die Verteilung der gesellschaftlichen Gesamtarbeit entsprechend der qualitativen Gliederung und der quantitativen Proportionalität der Ökonomie. Sie betrifft also die stoffliche und wertmäßige Proportionalität des Reproduktionsprozesses. Die Regulierung ist eine Funktion des jeweiligen Produktionsverhältnisses die sich durch die Ausbildung eines bestimmten Regulierungsmechanismus durchsetzt. Im Kapitalismus erfolgt die Regulierung durch das Zusammenwirken ökonomischer Gesetze. Der zentrale Regulierungsmechanismus im Kapitalismus ist das Wertgesetz, welches die Verteilung der Gesamtarbeit spontan regelt. Die Wirkungsweise und die Form der Regulierung und des Regulierungsmechanismus sind im Laufe der kapitalistischen Entwicklung und der Vergesellschaftung der Produktion und der Arbeit Anpassungen unterworfen. Einschneidende Veränderungen in den Anforderungen an die Proportionalitätserfordernisse führen zur Verschärfung des Widerspruchs von Produktionsverhältnis und Regulierungsmechanismus. Was bisher in der Umwälzung der Produktivkräfte und der Erhöhung des Vergesellschaftungsgrades, der Umwälzungen der Reproduktionsstrukturen und in einer Änderung und Anpassung des Regulierungsmechanismus, die eine den Proportionalitätserfordernissen entsprechende Verteilung von Arbeit und Kapital bewirken sollen, resultierte. Unter Regulierungsmechanismus wird auch die staatsmonopolistische Form kapitalistischer Wirtschaftsregulierung gefasst, die dazu beitragen soll, Grundstrukturen des Reproduktionsprozesses herbeizuführen, die den Anforderungen der Produktivkräfte entsprechen, sodass das Kapital verwertungsfähig bleibt und ein „normales“ Wachstum der Ökonomie möglich wird.
Bisher gab es drei Regulierungskrisen welche jedes mal eine historische „Bruchstelle“ in der kapitalistischer Entwicklung markierten. Die erste brach mit der zyklischen Überproduktionskrise der Jahre 1873 bis 1875 aus und bestimmte die wirtschaftliche Entwicklung bis zur Mitte der 1890er Jahre. Sie erzwang den Übergang vom Kapitalismus der freien Konkurrenz hin zum Monopolkapitalismus. Die zweite kapitalistische Regulierungskrise begann mit der großen Weltwirtschaftskrise der Jahre 1929 bis 1932 und setzte sich in der Periode der „Depression besonderer Art“ bis zum Anfang des zweiten Weltkriegs fort. Sie hatte die Verbindung der Macht der Monopole mit der des Staates zu einem einheitlichen staatsmonopolistischen Regulierungsmechanismus zur Folge. Zu Beginn der 1970er Jahre kam es zur dritten Regulierungskrise. Der Anpassungsspielraum der Produktionsverhältnisse wurde geringer. Es kam zu einer Anpassung innerhalb der Grundqualität des staatsmonopolistischen Kapitalismus, zur zunehmenden Internationalisierung des Monopolkapitals, zur Herausbildung neuer Formen der internationalen, kapitalistischen Koordinierung und zum Bedeutungsgewinn der Finanzmärkte, ihrer zunehmenden Verselbstständigung als Voraussetzung des internationalen Monopolisierungsprozesses usw. usf.
Wir sind der Ansicht, dass die bisherige kapitalistische Entwicklung an innere Schranken gestoßen ist, sodass Umwälzungen in Reproduktionsstruktur und Produktivkraftentwicklung, aber auch Anpassungen im bisherigen Regulierungsmechanismus erforderlich werden. Dabei bleibt es aber bei der Regulierung und Umverteilung im Interesse der großen finanzkapitalistischen Monopole. Die bisherige Strategie, den Verwertungsschwierigkeiten des Kapitals durch das Ausweichen auf die Finanzmärkte entgegenzuwirken, wird beibehalten. Auch die aktuelle Regulierungskrise verbleibt innerhalb der Grundqualität der staatsmonopolistischen Produktionsverhältnisse. Dabei weist die imperialistische Akkumulationsdynamik eindeutige Erschöpfungstendenzen auf. Die Fäulniserscheinungen des Imperialismus treten heute immer offensichtlicher zu Tage. Strukturelle Massenarbeitslosigkeit, stagnierende Produktion und gigantische Staatsverschuldung sind Folgen davon. Generelle Umbrüche in Reproduktionsstruktur und Produktivkraftentwicklung haben noch nicht stattgefunden, oder zeichnen sich zumindest nur allmählich ab, was auch für die besondere Tiefe der aktuellen Krise spricht. So wird die Stagnationstendenz durch den Umstand verstärkt, dass sich die Krise mit dem Auslaufen des mikroelektronischen und informationstechnischen „Kondratieff-Zyklus“ überschneidet, um es im Rückgriff auf die „Lange Wellen“-Theorie zu formulieren.
Langfristige Ursachen der Krise
Der Kapitalismus ist in eine tiefe und sehr lang anhaltende Verwertungskrise geraten, welche mit fallenden Profitraten und einer Überakkumulation von Kapital einhergegangen ist. Ein Überangebot an Geldkapital sorgte in der Vergangenheit für niedrige Zinssätze, welche die Verschuldung beförderten und zur Blasenbildung beitrug. Die Ausgabe von immer neuen Krediten überdeckte die Nachfragelücke, welche Ausdruck der stagnierenden Ökonomie ist. In der Krise von 2007 ff. offenbarte sich das Missverhältnis zwischen den Ansprüchen des zinstragenden Kapitals und den Möglichkeiten der Mehrwertproduktion. Die Fähigkeit, finanzielle Forderungen zu bedienen, wurde von zwei Seiten her untergraben. Die Überschüsse des realen Akkumulationsprozesses gingen zurück und gleichzeitig stiegen die Forderungen von finanziellen Investoren. Dies musste zu einer vorübergehenden Entwertung des fiktiven Kapitals führen. Aufgrund des Kursverfalls der Wertpapiere mussten Investmentbanken aber auch Geschäftsbanken erhebliche Verluste hinnehmen, weshalb sie die Kreditvergabe einschränkten. Doch geriet der Kreditmechanismus auch von Seiten der Produktion unter Druck. Die Unternehmen konnten aufgrund der Stockungen in der Produktion Kredite nicht mehr bedienen, auch deshalb mussten die Banken ihre Kredite drosseln. Während die Produktion ins Stocken geriet stiegen so die Kreditzinsen. Die auf die Finanz- und Kreditkrise folgende „Staatsschuldenkrise“ hat eine ihrer Ursachen darin, dass die Banken für Verluste entschädigt wurden, bzw. dass die Mehrwertansprüche des Kapitals weiterhin bedient wurden und werden. Die Krise der Staatsverschuldung, verstärkt durch die ungleichmäßige Entwicklung in der Euro-Zone, welche hohe Defizite in einigen Ländern verursachte, spitzte sich schließlich zu einer Krise der Währungsunion zu, welche ihre Existenz in Frage stellte.
Fallende Profitraten
In der Krise offenbarte sich das Problem der Überakkumulation von Kapital, welches 2009 schließlich zu einem starken Einbruch der Produktion führte. Vorausgegangen war dieser Entwicklung ein starker Fall der Profitrate. Fallende Profitraten sind Ausdruck für eine Verschlechterung der Verwertungsbedingungen des Kapitals. Eine absolute Überakkumulationssituation tritt dann ein, wenn jede weitere Akkumulation des Kapitals keine weitere Mehrwertsteigerung zustande bringt oder gar weniger Mehrwertmasse produziert wird als vor dem Wachstum des Kapitals. Es tritt dann ein starker Fall der Profitrate ein. Zwischen dem zweiten Viertel des Jahres 2007 und dem letzten Viertel des Jahres 2008 fand in den USA ein starker Rückgang bei den Profiten statt. Und zwar von 1003 Milliarden USD auf 283 Milliarden USD. Bei der Untersuchung der Profitrate macht es aber einen Unterschied, ob man den Profit in Relation zu dem Kapital das in Vergangenheit in Produktionsmitteln angelegt wurde (minus der Abschreibungen) setzt, oder ob man den Profit ins Verhältnis zu den aktuellen Kosten setzt, welche den Ersatz der alten durch neue Produktionsmittel decken. Naheliegend ist zunächst die erste Art der Berechnung, da sie Auskunft darüber gibt, wie sich das Kapital, welches für den Produktionsprozess verausgabt wurde, verwertet. Dies allein ist auch ausschlaggebend für den Erfolg eines Unternehmens. Andrew Kliman zeigt für die USA, dass die Profitrate seit den späten 1950er-Jahren im Fallen begriffen ist und dass die Profitrate auch nach dem ökonomischen Einbruch Mitte der 70er- und Anfang der 80er-Jahre nicht signifikant gestiegen ist. Zwischen 1982 und 2001 fiel die Profitrate (bezogen auf den Profit nach Abzug der Steuern) um 26,9 Prozent. Im Zuge der Krise sanken die Profitraten wiederum stark. Zu einem davon abweichenden Ergebnis kommt man, legt man die Profitraten als Verhältnis der Profite zu den aktuellen Kosten für Ersatzinvestitionen aus. Diese Profitratenberechnung gibt Auskunft darüber, ob sich die Investitionsbedingungen verbessern oder verschlechtern, da das Augenmerk auf Neuinvestitionen gerichtet ist, welche dazu führen sollen, die alten Produktionsmittel durch neue und auch effizientere zu ersetzen. Zwischen 1982 und 1997 stieg diese „Profitrate“ um 44 Prozent, fiel aber zwischen 1997 und 2001. Bis 2006 stieg diese Profitrate jedoch wieder an, um im Zuge der Krise aber wieder zu sinken. Dass beide Phänomene nebenher existieren können, eine generell fallende Profitrate und eine steigende Profitrate berechnet auf die Neuanlagen, hat damit zu tun, dass ein zusätzliches Kapital eine zusätzliche Profitmasse derart erbringen kann, dass die Profitrate berechnet auf dieses Zusatzkapital steigt, während berechnet auf das bisher engagierte Kapital, dieses zusätzliche Kapital keine allgemeine Steigerung der Profitrate bewirkt.
Verlangsamte Akkumulation
Gleichzeitig mit dem Fall der Profitrate (Profit in Relation zu dem Kapital das in Vergangenheit in Produktionsmitteln angelegt wurde) verlangsamte sich die Kapitalakkumulation. Beides geht Hand in Hand. Dennoch führt gerade die verlangsamte Akkumulationsdynamik zu einer Umschichtung der Profite hin zu Investition in Finanztitel.
Überschüssiges Geldkapital
Das Wachstum anlagesuchenden Geldkapitals geht somit auch auf die zunehmenden Schwierigkeiten der Verwertung des Kapitals in der Produktion zurück. In den letzten Jahrzehnten ist der Anteil der Investitionen an den Profiten beständig zurückgegangen. Dem verlangsamten Wachstum der Realökonomie steht die explosionsartige Aufblähung der Finanzsphäre gegenüber. Die Finanzsphäre entfernt sich über den Zyklus hinaus von ihrer materiellen Grundlage im Reproduktionsprozess. Dabei gilt die Krise der 1970er und Folgejahre als einschneidendes Moment. In den zyklischen Überproduktionskrisen der Jahre 1974/75 und 1980/82 konnte trotz der enormen Kapitalentwertung das relativ überschüssige Kapital nicht so weit abgebaut werden, dass dadurch ein erheblicher konjunktureller Aufschwung begünstigt hätte werden können. So haben sich seit den frühen 1980er Jahren der Aktienindizes in den USA und in Deutschland etwa mehr als verzehnfacht, während sich das Investitionswachstum über weite Strecken verlangsamt hat und deutlich hinter dem Anstieg der Unternehmensgewinne zurückgeblieben ist. Die Aufblähung der Finanzsphäre kann jedoch nicht ausschließlich über nicht wieder direkt in die Akkumulation eingehende Profite erklärt werden. Diesen Schluss legt schon die Tatsache nahe, dass die Finanzmärkte bei weitem rascher wachsen als die Realakkumulation. Von 1996 bis 2006 wuchs das globale Finanzvermögen mit einer jährlichen Rate von 9,1 Prozent, wohingegen das globale BIP um jährlich 5,7 Prozent wuchs. Diese Entwicklung muss vor allem auch auf die Fähigkeit der Finanzmärkte zurückgeführt werden, Kreditgeld in gewaltigem Umfang zu schöpfen. Den spekulativen Finanztransaktionen liegt die Gewährung immer neuen Kredits seitens der Finanzkonzerne zugrunde. Die Akkumulation von Ansprüchen auf den Mehrwert konnte über einen längeren Zeitraum hinweg relativ unabhängig von der realen Akkumulation ausgedehnt werden. Gleichwohl erhöht sich der Druck auf das produktiv fungierende Kapital die Mehrwertansprüche zu bedienen.
Fallendes Zinsniveau
In den letzten Konjunkturzyklen ist die Durchschnittsrate des Zinses beständig gefallen. Dies war Folge des enormen Kapitalüberschusses, der nicht ausreichend produktiv verwertet werden konnte. Das gefallene Zinsniveau ist Ausdruck eines Überschusses an Geldkapital und hängt auch zusammen mit dem tendenziellen Fall der Profitrate. Je niedriger die Profitraten sind, zu desto niedrigeren Zinsraten kann sich das Geldkapital verwerten. Es sinkt die Bereitschaft und die Fähigkeit des produktiv fungierenden Kapitals hohe Zinsen zu bedienen. Nicht nur der Geldmarktsatz für Dreimonatsgeld weist seit den letzten Jahrzehnten eine eindeutige Tendenz zum Sinken auf, sondern auch der langfristige Zinssatz für Staatsanleihen. Der Realzins auf Staatsanleihen der G10 Staaten fiel von etwa 7 Prozent im Jahre 1984 auf 1,39 Prozent im Jahre 2008. Die Realzinsen für langfristige Anleihen lagen von 2000 bis 2007 in Deutschland bei 4,16 Prozent gegenüber 8,05 Prozent in den Jahren 1973 bis 1980. In den USA lag der langfristige Zinssatz bei 4,7 Prozent in den Jahren 2000 bis 2007 gegenüber 6,7 Prozent in den Jahren 1991 bis 2000 und in Japan lag dieser Zins bei 1,46 Prozent in den Jahren 2000 bis 2007 gegenüber 3,71 Prozent in den Jahren 1991 bis 2000.
Nachfrageschwäche
Die verlangsamte Akkumulationsdynamik aufgrund der Verwertungsschwierigkeiten zog eine schwache gesamtwirtschaftliche Nachfrage nach sich. Zumal die Löhne niedrig gehalten und Sozialausgaben gestrichen wurden. Die Lücke zwischen den Produktionsmöglichkeiten und der zurückbleibenden Nachfrage wurde immer größer. Die Wachstumsschwäche seit den 1970er Jahren „wurde zwar partiell durch die explosionsartige Zunahme der Verschuldung (…) verschleiert, d.h. aufgrund immensen Kreditaufnahmen konnte für die erstaunlich lange Periode von drei Jahrzehnten die Wachstumsabschwächung teilweise latent gehalten werden. Das Wachstum reichte jedoch seit Anfang der 1980er Jahre nicht mehr aus, um den Anstieg der Massenarbeitslosigkeit zu verhindern (…).“ (1)
Reproduktionsstruktur
Die im Zuge der Krise zur Geltung kommenden Disproportionen in der Wirtschaft haben sich in einer beträchtlichen Zunahme der Überakkumulation von Kapital niedergeschlagen. Der Kapitalüberschuss tritt dabei in verschiedenen Formen auf, so in der Überakkumulation von fixem Kapital, in Gestalt von nichtausgelasteten Produktionskapazitäten, bis hin zu der Form eines Überschusses von anlagesuchendem Geldkapital. Dem gegenüber steht eine schwache Nachfrage. Die Krisenentwicklung verläuft jedoch in verschiedenen Ländern unterschiedlich und bringt auch unterschiedliche Wirtschaftswachstumsdynamiken hervor. In einigen Ländern scheint sich die Situation (vorerst) einigermaßen entspannt zu haben, so war in den USA seit 2010 das Wirtschaftswachstum positiv und lag zuletzt im Jahr 2013 bei 2,2 Prozent. Auch Länder der EU verzeichnen teils positive Wachstumsergebnisse, in Deutschland etwa wurde das Wirtschaftswachstum 2014 mit 1,5 Prozent veranschlagt, 2013 betrug es 0,1 Prozent, während in der Eurozone ein Negativwachstum von 0,1 Prozent erzielt wurde und das Wachstum auch für 2014 nur mit 0,8 Prozent veranschlagt wird. 2013 wiesen unter anderem Länder wie Griechenland, Spanien, Portugal, Italien, Zypern und Slowenien einen Rückgang in der Wirtschaftsleistung (sinkendes Bruttoinlandsprodukt) und somit eine Rezession auf.
Die Frage ist, ob die Disproportionen in der Ökonomie auf absehbare Zeit überwunden werden, sodass sie den Verwertungsbedürfnissen des Kapitals entsprechen, ein „normales“ Wachstum erreicht ist und realisierte Profite wieder überwiegend mehrwerterhöhend angelegt werden können. Ein Indikator für die Überakkumulation von fixem Kapital ist der sogenannte Output Gap. Er misst die Differenz vom realisierten Bruttoinlandsprodukt zum Produktionspotential. Sind die Produktionskapazitäten nicht voll ausgelastet, ist der Output Gap negativ. 2009 war die Produktionslücke der entwickelten kapitalistischen Länder erstmals seit 2003 wieder negativ. Sie betrug ‑4,5 Prozent. Seither ist die Produktionslücke etwas geringer geworden. 2011 betrug sie ‑2,6 Prozent. 2013 betrug sie ‑3 Prozent. Nach Schätzungen des IWF beträgt sie für das Jahr 2014 immer noch ‑2,5 Prozent. In den USA ist die Produktionslücke sogar größer als in der Euro-Zone. In den USA betrug sie 2013 ‑4,4 Prozent, während sie in der Euro-Zone ‑3 Prozent betrug. Das bedeutet, dass zu viel Kapital in Produktionsmittel investiert wurde, welches dabei ist zu entwerten, indem Anlagen still gestellt werden, sodass die Akkumulation des produktiven Kapitals ins Stocken gerät. Aber auch eine Entwertung der Elemente des Kapitals findet statt und schafft teils günstigere Ausgangsbedingungen für Investitionen. Zwar gingen im Euroraum die Preise für Vorleistungsgüter zwischen August 2014 und Jänner 2015 beständig zurück, über denselben Zeitraum zogen aber die Preise für Investitionsgüter an, was dazu beiträgt, dass Neuanschaffungen von Produktionsmitteln verhalten bleiben. Die Krise sorgte aber insbesondere für einen Verfall der Ölpreise. Dies wirkt auch belebend auf die Konjunktur. Einerseits hat das schwache globale Wirtschaftswachstum die Nachfrage nach Öl gedämpft. Andererseits ist das Angebot durch verschärften globalen Wettbewerb deutlich gestiegen. Dank der Fracking-Technologie fördern die USA immer mehr Öl. Gleichzeitig weigerte sich Saudi-Arabien, seine Ölexporte zu reduzieren, wie die Regierung es sonst zu Zeiten eines Überangebots getan hat. Darin spiegelt sich auch ein Preiskrieg wider, den Saudi-Arabien und die USA gegen den Iran, Venezuela und Russland führen. Hinzu kommt, dass die EU- und US-Sanktionen gegen Russland auch auf die Ölindustrie abzielen. So wurde Russlands größter Ölkonzern Rosneft von den westlichen Kapitalmärkten ausgeschlossen. In Libyen und Irak läuft die Ölförderung weiter. Energieproduzenten verbessern ihre Produktionstechniken und nutzen verstärkt Informationstechnologie, um die Kosten zu drücken. Die Industrie wird immer effizienter – was die Phase des Überangebots sogar verlängern könnte.
Auch schafften die Zentralbanken günstigere Ausgangsbedingungen für eine stärkere Kreditnachfrage, indem sie die Zinsen drastisch senkten und damit die Marktbewegungen nachvollzogen. Doch scheint dies derzeit zumindest im Euroraum nicht zu gelingen. Die Kreditkonditionen der Banken lockern sich nur zaghaft und die Kreditnachfrage in der Euro-Zone bleibt verhalten. Die Nettokreditnachfrage von Unternehmen die damit Investitionen finanzieren, war im letzten Viertel 2014 erstmals seit 2011 wieder signifikant positiv und lag bei 11 Prozent. Die Nettokreditnachfrage ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Prozentsatz an Banken die einen Anstieg der Nachfrage verzeichnen und den Banken die einen Rückgang verzeichnen. Generell stocken die Neuinvestitionen. Die Investitionen gingen in den entwickelten kapitalistischen Ländern 2008 gegenüber dem Vorjahr um 2,9 Prozent zurück. 2009 betrug der Rückgang 11,6 Prozent. Seither wachsen die Investitionen nur schwach, zwischen 2010 und 2013 im Durchschnitt nur um 1,8 Prozent. Von 1996 bis 2005 betrug das Wachstum der Investitionen durchschnittlich 3,5 Prozent. Aber während in den USA die Investitionen stärker anziehen, zwischen 2010 und 2013 um durchschnittlich 3,2 Prozent, gingen die Investitionen in der Eurozone sogar zurück, zwischen 2010 und 2013 um ‑1,4 Prozent. In der Euro-Zone und der gesamten EU stagniert die industrielle Produktion (die Entwicklung des Outputvolumens) seit 2010 auf einem niedrigen Niveau, nachdem sie 2008 und 2009 massiv eingebrochen war.
Dem gegenüber steht die weitere Aufblähung der Finanzsphäre. Das weltweite Finanzvermögen machte im Jahr 2007 206 Billionen US-Dollar aus. Zwar unterbrach die Finanzkrise von 2008 diesen Trend kurzzeitig und das fiktive Kapital wurde entwertet, doch wuchsen die Finanzvermögen weiter an. 2008 ging das Finanzvermögen zwar krisenbedingt um 8,3 Prozent zurück, also um 17 Billionen Dollar. 2009 stieg dieses aber bereits wieder auf 206 Billionen Dollar an, somit wurde der Verlust vollständig wettgemacht. Ende 2010 waren es bereits 219 Billionen Dollar, die weltweit nach profitablen Anlagemöglichkeiten suchten. Bis 2012 ist das Finanzvermögen noch weiter auf 225 Billionen Dollar angewachsen. Allerdings hat sich das Wachstum verlangsamt. Betrug die jährliche Wachstumsrate des globalen Finanzvermögens von 2000 bis 2007 noch 8,1 Prozent, so in den Jahren von 2007 bis 2012 „nur noch“ 1,9 Prozent. Beides, eine schwache Realakkumulation und wachsende Finanzvermögen, begünstigen die Krisenanfälligkeit des Kapitalismus.
Produktivkräfte
Neue Wachstumsimpulse, welche von einer entsprechenden Produktivkraftentwicklung getragen sind, sind derzeit noch nicht eindeutig auszumachen. Mit dem Auslaufen des mikroelektronischen und informationstechnischen „Kondratieff-Zyklus“ stellt sich die Frage nach Umwälzungen in der Produktivkraftentwicklung, die einen neuen „Aufschwung“ begünstigen können. Der Aufschwung, gemäß der Theorie der Langen Wellen, ist verbunden mit Innovation und Expansion, getragen von bestimmten Leitsektoren. Sobald sich dieser abschwächt und an die Grenzen der Erneuerung stößt, tritt die Phase des Abschwungs ein. Im Abschwung erlebt die Wirtschaft nicht nur Kontraktion, es bildet sich bereits auch die technologische und sektorale Antriebskraft heraus, welche die nächste Phase des Aufschwungs trägt. Zum Beispiel wird die dritte Kondratieff-Welle in Verbindung gebracht mit dem Zeitalter der Stahlproduktion, der Elektrizität und der Schwerindustrie. Die vierte Welle geht einher mit Ölproduktion, Automobilindustrie und Massenerzeugung. In der fünften Welle wiederum dominieren Informations- und Telekommunikationstechnologien. Der Abschwung eines Kondratieff-Zyklus ist im Übrigen weitestgehend übereinstimmend mit den Umbrüchen welche die Regulierungskrisen hervorbringen. Was naheliegend ist, da in Regulierungskrisen die bisherigen Reproduktionsstrukturen an ihre Grenzen stoßen, bedingt durch eine ungünstige organische Zusammensetzung des Kapitals, sodass sich die Verwertungsbedingungen verschlechtern. Damit die Verwertungsbedingungen verbessert werden können, muss es zu einer Umwälzung in den Produktivkräften kommen, welche es ermöglicht, die Akkumulation auf effizienterer Grundlage voranzutreiben. Dies ist verbunden mit einer Umwälzung in der Reproduktionsstruktur, welche den Proportionalitätserfordernissen entspricht, und welche so mit den Produktivkraftanforderungen übereinstimmt, dass ein „normales“ Wachstum erreicht werden kann.
Bisher hat keine grundlegende Umwälzung in der Produktivkraftentwicklung stattgefunden, welche das Wachstum der Wirtschaft entschieden vorantreibt, doch bilden sich auch schon Technologien heraus, die eine solche Umwälzung begünstigen könnten. So sind neuartige Fertigungsmaschinen mit Prozessoren, Sensoren und Funkverbindungen ausgestattet. Sie kommunizieren selbstständig miteinander und mit den Produkten, die sie fertigen. Sie organisieren sich selbst und optimieren ihre Abläufe: Die smarten Maschinen überprüfen selbst die Lager- und Produktionsstände, bestellen nach, rüsten um. Auch auf Störungen und Ausfälle wird rasch, flexibel und selbsttätig reagiert. Das Ganze läuft bereits unter dem Begriff Industrie 4.0 an. „Mit Industrie 4.0“, so formuliert es Henning Kagermann, Präsident der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften acatech, „haben wir nach der Mechanisierung der Fertigung im 18. Jahrhundert, der arbeitsteiligen Massenproduktion durch Einführung des Fließbands im 19. Jahrhundert sowie dem Einsatz von Elektronik und IT zur Automatisierung in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts, nichts weniger als die vierte industrielle Revolution eingeleitet. Industrie 4.0 wird die umfassende Individualisierung von Produkten ermöglichen und dabei Fertigung, Handel und Vertrieb radikal verändern.“ Doch bisher bleibt die Einführung der neuen Produktivkräfte noch verhalten. In Deutschland ergab 2014 eine Unternehmerbefragung, dass der Begriff „Industrie 4.0“ bislang nur 57 Prozent aller befragten Personen bekannt ist. Etwa ein Drittel der befragten Betriebe, denen der Begriff bekannt ist, haben bereits heute Maschinen und Anlagen mit eingebetteten, vernetzten Systemen (CPS) in Verwendung. Moderne Produktionssysteme (z.B. Industrieroboter) oder dezentrale Anlagen (z.B. Windkraftanlagen) sind Anwendungsbeispiele. Die zunehmende Vernetzung von Objekten in Fertigungsprozessen wird auch bei Transporttechnologien oder Produkten deutlich, die bei etwa einem Viertel der befragten Betriebe – häufig mittels RFID – Informationen übertragen können. Auch CPS-Plattformen, die die Daten der vernetzten Objekte sammeln, aufbereiten und analysieren, finden bereits bei einigen Unternehmen Anwendung. Viele Unternehmen haben demnach erste Schritte zu einer vernetzten Fertigung getan. Doch in den USA ist dieser Prozess zu effizienteren Produktionsverfahren schon weiter fortgeschritten. Der US-Konzern GE hat unter der Bezeichnung „Industrial Internet“ eine große Forschungsinitiative losgetreten, die nicht nur die Fertigung, sondern die gesamte industrielle Infrastruktur intelligent vernetzen will. Und die US-Regierung bewilligte allein bis 2013 zwei Milliarden US-Dollar für ein Forschungs- und Entwicklungsprogramm zum Thema „Advanced Manufacturing“, dem amerikanischen Pendant zu Industrie 4.0. Diese Summe ist etwa das zehnfache dessen, was die deutsche Regierung bis dahin in die vergleichbare Forschung steckte. Die europäische Industrie ist somit ins Hintertreffen geraten. Bei der Entwicklung smarter Systeme vertraut man auf Maschinen und Technologie aus dem asiatischen und dem US- amerikanischen Raum. Im US-Technologiesektor sorgen steigende Investitionsausgaben und neue Innovationen für steigendes Wachstum. So kommen viele technologische Innovationen aus den USA. Etwa im Bereich des mobilen oder drahtlosen Internets, ebenso beim 3D-Druck, fahrerlosen Autos, fortgeschrittener Robotertechnik, Energieexploration, Advanced Materials, künstlicher Intelligenz, Bio- oder Nanotechnologie. Manche dieser technologischen Innovationen könnten die Produktivkraftentwicklung durchaus vorantreiben. Dem steht entgegen, dass sich bisher noch keine grundlegend neue Reproduktionsstruktur herausgebildet hat, und dass sich die Verwertungsbedingungen des Kapitals nicht durchgehend verbessert haben. Vor allem in der EU hat sich eindeutig noch keine Erholung der Verwertung eingestellt. In den USA jedoch verläuft die Entwicklung der Kapitalakkumulation günstiger, wenngleich die Überkapazitäten in der Produktion hoch bleiben. Die kapitalistischen Staaten fördern jedoch die neuen Produktivkraftpotentiale, um die Verwertungsbedingungen zu verbessern. Umwälzungen in den Produktivkräften vollziehen sich zudem nicht schlagartig, dies ist vielmehr ein längerfristiger Prozess, der einer längeren Forschungs- und Entwicklungsphase bedarf, sowie Kooperations- und Vorbereitungsaktivitäten sowohl seitens der Konzerne als auch seitens der Regierungen.
Regulierung
Regulierungskrisen bewirken auch, dass sich die Ausprägungen des zentralen Regulierungsmechanismus, die des Wertgesetzes ändern. Während im Kapitalismus der freien Konkurrenz über den Konkurrenzkampf der Kapitale die Herstellung der volkswirtschaftlichen Proportionen erfolgte und sich durch die freie Kapitalwanderung eine allgemeine oder Durchschnittsprofitrate herausbildete, so wurde im Zuge der ersten Regulierungskrise, welche mit der Krise der Jahre 1873/75 einsetzte, die Herausbildung des Monopols befördert, was schließlich um die Wende zum 20. Jahrhundert zur Entstehung des Monopolkapitalismus führte. Die Konkurrenzbeziehungen haben sich derart geändert, dass sich der Monopolprofit und der Monopolpreis herausbildeten. Die Monopole blockieren und deformieren gleichzeitig den Regulierungsmechanismus, indem notwendige Ausgleichsprozesse im Reproduktionsprozess gehemmt werden. Mit der zweiten Regulierungskrise, die 1929 einsetzte, kam es zur Ausprägung des staatsmonopolistischen Kapitalismus. Der Staat interveniert und reguliert zugunsten der Monopole und des Monopolprofits der weiterhin den Regulierungsmechanismus bestimmt. Auch mit dem Beginn der dritten Regulierungskrise ab den 1970er Jahren bleiben der Monopolprofit und der Monopolpreis bestimmend, jedoch bildet sich mehr und mehr das finanzkapitalistische Monopol heraus, das regelmäßig höhere Profitraten einfährt als das „gewöhnliche“ Monopol. Lucas Zeise führt aus, dass an den entscheidenden Stellen die Hochfinanz über den Hebel verfügt, „um die ökonomische Regulierung durch den Staat zu ihren Gunsten ablaufen zu lassen (…). Es findet eine vom Staat organisierte Umverteilung der Gewinne zugunsten der besonders großen und mächtigen Kapitalgruppen statt.“ Nämlich zugunsten der finanzkapitalistischen Monopole. Es gibt im Wesentlichen zwei Mechanismen, die zusammengenommen die dauerhaft hohen Gewinne des Finanzsektors erklären: „Das eine ist die schrankenlose Kreditausweitung. Sie ist nur dann schrankenlos, wenn wie unter den Bedingungen des neoliberalen Deregulierungsmodells der Staat der Kreditausweitung keine Grenzen setzt. Der zweite Mechanismus ist die Spekulation, die vom Staat gestattet oder besser gefördert, den Finanzsektor zur Wundermaschine macht und Gewinne erscheinen lässt, die nicht der Mehrwertproduktion entstammen.“(2) Somit folgt die staatliche Regulierung auch den Erfordernissen des finanzmonopolistischen Produktionsverhältnisses. Bisher hat sich der grundlegende Regulierungsmechanismus nicht qualitativ geändert und es bleibt bei einer Regulierung und Umverteilung im Interesse der finanzkapitalistischen Monopole. Ja diese Form der Umverteilung wird weiter vertieft, was auch als Form der Anpassung des Regulierungsmechanismus verstanden werden muss.
Bankenrettung
Bei der Krisenintervention standen zunächst die Bankenrettung und die Restrukturierung der privaten Banken durch Staatshilfe, staatliche Geldschöpfung und die Förderung von Fusionen im Vordergrund. Die Bereinigungsfunktion in der gegenwärtigen Krise wurde so blockiert, womit die Ursachen der Krise verschleppt wurden. Eine ausreichende Kapitalvernichtung wurde durch die staatlichen Entschädigungen der Mehrwertansprüche verhindert. Die Rettung des Finanzsektors mittels staatlicher Maßnahmen ist wesentlicher Grund für die starke Aufblähung der Staatsverschuldung einzelner Länder. Zwar entwerteten in der Finanzkrise kurzzeitig auch Finanztitel. Aber zeitgleich wurden die Banken und Finanzinstitute erneut zu Profiteuren. Dank exorbitanter Rettungspakete, Hilfsgelder und staatlicher Interventionen saniert, kreditierten die Banken und Finanzinvestoren jetzt, begünstigt noch durch renditefreundlich niedrige Zentralbankzinsen, die Staatsschuldenaufblähung und erschlossen sich so inmitten der Krise ein einträgliches Geschäft mit Staatsanleihen, welches zudem noch vielfach die Zinsens in die Höhe trieb und eine Reihe von Spekulationsfeldern eröffnete. Das statutarische Staatsfinanzierungsverbot durch die EZB bzw. nationalen Notenbanken des Eurosystems erlaubte es den Finanzakteuren innerhalb der Euro-Zone ein besonders lukratives Geschäftsfeld zu erschließen. Die von der EZB zu einem sehr niedrigen Leitzins kreditierten Banken brauchten die allzeit gewährten EZB-Milliarden lediglich zu höheren Zinssätzen an die öffentlichen Hand der Kern-Länder oder eben zu noch höheren Zinssätzen an die „Problemländer“ weiterreichen und die Zinsdifferenz einstecken. Die Notenbanken sind in der Krise vermehrt in die Rolle von Gläubigern geschlüpft: Notenbankkredite ersetzten nach Ausbruch der Krise einen Gutteil des Interbankenmarkts, also der Refinanzierung, die Banken einander zuvor gewährt hatten. Die EZB trat und tritt auch als Ankäuferin von Staatsanleihen auf dem Sekundärmarkt auf. Beides ermöglichte privaten Gläubigern, sich riskanter Anlagen in Krisenregionen zu entledigen. Dadurch ist es aber vorerst gelungen, systemische Risiken, die sich aus der Verkettung von Verbindlichkeiten ergeben, zu entschärfen.
Austeritätspolitik und Strukturreformen
Als Reaktion auf die hohe Staatsverschuldung zielten die EU-Initiativen als Reaktion auf die Krise fast alle auf den Abbau der Staatsverschuldung ab. Diese Politik ist besonders brutal in jenen Ländern umgesetzt worden, die sich aufgrund der Krise nicht mehr auf den Finanzmärkten refinanzieren konnten. Die Prämien für eine Absicherung gegen den Ausfall von Staatsanleihen insbesondere von Griechenland, aber auch von Portugal, sind bis Ende 2011 stark angestiegen. Italien und Spanien mussten 2012 ein sehr großes Volumen an aufgenommenen Staatsanleihen zurückzahlen. Italien hat einen Kapitalbedarf – die Jahre 2012 bis 2014 zusammengerechnet – von insgesamt 956 Milliarden Euro, Spanien von 453 Milliarden Euro. Fünf Länder – Griechenland, Irland, Portugal, Spanien und Zypern – mussten zeitweilig unter den Euro-Rettungsschirm schlüpfen und wurden zu sogenannten Programmländern. Neben drastischer Austerität verordnet die Krisenpolitik „Strukturreformen“. Im Gegenzug gab und gibt die Troika, bestehend aus EU-Kommission, der EZB und dem Internationalen Währungsfond (IWF), Kredittranchen aus den Rettungsschirmen frei (nunmehr aus dem Europäischen Stabilitätsmechanismus, kurz ESM). Die geforderten Austeritätsmaßnahmen sollten in den überschuldeten Staaten den Finanzierungsbedarf der öffentlichen Haushalte senken und so Haushaltsdefizite abbauen, die staatliche Kreditwürdigkeit in den Augen des Finanzkapitals stärken und den Schuldenstand senken. Doch zeigte sich in Ländern wie Griechenland, dass drastische Ausgabensenkungen in einer rezessiven Situation das Wachstum reduzieren, was zu Steuerausfällen und Ausgabensteigerungen (etwa für die Arbeitslosenunterstützung) führt, wodurch der Schuldenstand im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung sogar ansteigt. Unter dem Slogan der „Strukturreformen für mehr Wettbewerbsfähigkeit“ erfolgten drastische Eingriffe, die bisher am Widerstand der Gewerkschaften und sozialer Bewegungen gescheitert waren (3): Im Bereich der Lohnpolitik kam es etwa zur Reduktion bzw. zur Einfrierung von Mindestlöhnen, zur Abschaffung, Aussetzung oder zeitlichen Limitierung von Kollektivverträgen und zur Verlagerung der Kollektivvertragsverhandlungen auf die Betriebsebene. Im Bereich der Pensionen wurde das Antrittsalter an die Lebenserwartung gekoppelt, die Beitragszeiten massiv verlängert und die Höhe der Zahlungen gekürzt. Und im Arbeitsrecht wurde eine Erleichterung von Kündigungen, eine Verlängerung der Wochenarbeitszeit und einen Ausbau von befristeter Beschäftigung und Zeitarbeit durchgesetzt. Auch die Einschnitte in die Gesundheitssysteme gehen derart tief, dass etwa in Griechenland nicht einmal mehr eine gesundheitliche Grundversorgung gewährleistet ist. Außerdem kam es zu einem weiteren Abbau des öffentlichen Sektors. Die beiden Leitlinien „Strukturreformen“ und „Austerität“ bestimmen auch jene Instrumente der Krisenpolitik, mit der die im südlichen Labor erprobten Maßnahmen europäisiert werden. Im Zentrum dieser Bemühungen steht die sogenannte New Economic Governance, bestehend aus Six-Pack und Two-Pack und dem Fiskalpakt. Der Six-Pack ermöglicht es Sanktionen gegen die Verletzung des Stabilitäts- und Wachstumspakt schon sehr viel früher als bisher anzudrohen und zu beschließen. Im Rahmen des Europäischen Semesters sind die Euro-Länder verpflichtet, ihre Haushaltspläne für das kommende Jahr jährlich im Oktober an Brüssel zu übermitteln. Auf diese Weise kann die Kommission frühzeitig überprüfen, ob sie den Anforderungen des Stabilitäts- und Wachstumspakts entsprechen. Mit dem Two-Pack werden Mitgliedsstaaten mit ernsthaften finanziellen Schwierigkeiten oder solche, die schon finanzielle Unterstützung erhalten, einer intensiveren Überwachung ihrer finanziellen und wirtschaftlichen Lage unterworfen. Durch den Fiskalpakt verpflichten sich die Mitgliedstaaten einen Großteil der regelgebundenen Finanzpolitik auch in Form einer vorzugsweise verfassungsrechtlich abgesicherten Schuldenbremse zu übernehmen, die mit einem automatischen Korrekturmechanismus zu verbinden ist. Auch im Bereich der „Strukturreformen für mehr Wettbewerbsfähigkeit“ kam es zu einer Europäisierung der Krisenpolitiken. Im Zentrum steht das im Rahmen der New Economic Governance beschlossene Verfahren bei ökonomischen Ungleichgewichten, dass so ausgestaltet ist, dass es insbesondere auf Länder mit Leistungsbilanzdefiziten fokussiert. Wenn „nötig“ kann die Kommission die Mitgliedstaaten zur inneren Abwertung durch Lohnsenkung und Abbau des Arbeitsrechts im Wege eines Korrekturmaßnahmenplans verpflichten und allenfalls empfindliche Geldbußen verhängen.
Eurokrise
Die ungleichmäßige Entwicklung in der EU wird durch Kreditgewährung und der damit verbundenen Austerität und Strukturreformen nicht beseitigt. Diese wurde bereits mit der Einführung des Euro befördert, welche vorsah, dass Länder mit Defiziten nicht etwa durch Finanzausgleich oder Monetarisierung der öffentlichen Haushalte mittels der europäischen Zentralbank gestützt werden. Und auch trotz dieser „Fehlkonstruktion“, blieb die Euro-Zone bisher erhalten. Die Krise des Euro ist im engeren Sinn keine Währungskrise, da es weder zu einer hohen Inflationsrate, noch zum Absturz des Außenwertes der Währung, noch zu einer hohen Verschuldung für die Euro-Zone als Ganzes kam. Die Krise des Euro resultierte vielmehr aus der zugrundeliegenden Weltwirtschaftskrise, welche das Problem der ungleichmäßigen Entwicklung und hoher Leistungsbilanzdefizite zusätzlich durch die wachsende Staatsverschuldung verschärfte. Die Euro-Krise ist also eine Schuldenkrise und eine Zahlungsbilanzkrise, die aus der Wirtschaft- und Finanzkrise entsprang und besteht darin, dass einzelne Länder ihre Staatschulden nicht mehr refinanzieren konnten. Die Währungsunion bot den wettbewerbsschwächeren Ländern anfangs massiv niedrige Zinssätze auf ihre Staatsanleihen, was zur Blasenbildung beitrug. Die Zinsniveaus differierten jedoch bei Ausbruch der Euro-Staatsschuldenkrise wieder stark und die Vorteile waren dahin. So schnellten die Refinanzierungskosten auch durch spekulative Attacken auf ein nicht mehr beherrschbares Niveau. Die betroffenen Länder konnten, da sie ihre nationalen Währungen aufgegeben hatten, nicht mehr den Weg über die Monetarisierung ihrer Schulden mittels ihrer nationalen Zentralbanken gehen oder eine Abwertung zugunsten einer erhöhten Konkurrenzfähigkeit ihre Produkte vornehmen. Doch die wirtschaftlichen und politischen Eliten zielten auf einen unbedingten Erhalt der Euro-Zone, was jedoch nicht bedeutet, dass die Euro-Zone nicht auch zerbrechen könnte. Die Gefahr für private Gläubiger wurde zumindest gebannt, indem ihnen die EZB Staatsanleihen der von der Krise am meisten betroffenen Länder abkauft. Die Situation beruhigte sich einigermaßen, als EZB-Präsident Mario Draghi im Juli 2012 ankündigte, dass die EZB alles in ihrer Macht stehende tun werde, um den Zusammenhalt der Eurozone sicherzustellen. In Folge wurde das Outright Monetary Transaction Programm (OMT) beschlossen, das vorsieht, dass Käufe von Staatsanleihen, die als endgültige Transaktionen durchgeführt werden, vom Eurosystem am Markt unbefristet erfolgen. Die Käufe erfolgen aber ausschließlich auf dem Sekundärmarkt also nicht direkt vom begebenden Staat. Doch obgleich das Programm nicht zum Einsatz kam, verringerten sich die Risikoaufschläge in den Peripherieländern der Eurozone stark und anhaltend. Die fallenden Risikoaufschläge auf langfristige Staatsanleihen bremsten den Anstieg der Staatsschulden jedoch nur geringfügig. Die Verschlechterung der Schuldendynamik war in jenen Ländern am deutlichsten, welche die umfangreichste Sparpolitik forcierten. Erst Anfang 2015 hat die EZB damit begonnen, Staatsanleihen systematisch aufzukaufen. Bisher kam es aber nicht zur Einführung der vieldiskutierten Euro-Bonds. Diese könnten so aussehen, dass eine gemeinsame Finanzagentur der Euro-Staaten Anleihen verkauft, wobei die einzelnen Staaten ihre Kredite entsprechend des bestehenden Bedarfs bedienen müssten. Die Schulden werden also nicht zusammengeworfen, jedoch werden die Schulden gemeinsam vermarktet und jeder Staat würde die gleichen Zinsen zahlen. Von Seiten Deutschlands wurden die Euro-Bonds immer schon energisch abgelehnt, nicht zuletzt wegen der Befürchtung, dies würde die Zinsen auf die Anleihen für Deutschland erhöhen. Dazu kommt aber auch noch die Logik der deutschen Eliten, dass unterschiedliche Zinsentwicklungen gerade disziplinierend auf die verschuldeten Staaten wirken sollen. Demnach zeichnet sich ab, dass zwar die radikale Sparpolitik europäisiert werden soll, die führenden Eliten jedoch verhindern wollen, dass die Schulden einzelner Länder zu sehr vergemeinschaftet werden könnten. Im Falle der Euro-Bonds befürchtet man, dass die europäischen Staaten den Gläubigern gegenüber als Gesamthaftende auftreten müssten. Es zeichnet sich so eine Regulierung im Euroraum ab, welche langfristige Maßnahmen in Richtung einer Umverteilung hin zum Finanzkapital über den nationalen Rahmen hinweg vornimmt, mit einigen Staaten im Zentrum, die einen Leistungsbilanzüberschuss und starke Gläubigerpositionen aufweisen (Belgien, Deutschland, Niederlande, Österreich, Finnland, Luxemburg, mit Deutschland an der Spitze), die allerdings eine Umverteilung in die andere Richtung, hin zu einer Aufhebung der ungleichmäßigen Entwicklung und einer Entlastung der Peripherie (insbesondere Griechenland, Italien, Spanien, Portugal, Irland, Zypern) unterbinden will.
Anpassungen im Regulierungsmechanismus
Damit sind einige wesentliche Anpassungen im Regulierungsmechanismus angesprochen. Es kommt zu einer Vertiefung der Umverteilung zugunsten des Finanzkapitals. Die Kosten der Krise wurden weitestgehend sozialisiert. Dafür werden radikale Sparmaßnahmen zu Lasten der Arbeiterklasse und des Volkes umgesetzt. Die Ausbeutungsrate wird durch niedrigere Löhne, längere Arbeitszeiten, späteren Pensionseintritt etc. erhöht und langfristig verankert. Diese Entwicklung soll möglichst europäisiert werden, während das Grundgerüst der Währungsunion unangetastet bleibt, dass Schulden weitestgehend nicht vergemeinschaftet werden. Diese Maßnahmen sind Ausdruck des hohen Grades der Verflechtung des Kapitals, wobei die Interessen der nationalen Monopolkapitale, vor allem aber die der dominierenden Staaten Europas, gewahrt werden. Doch zeichnet sich auch im internationalen Maßstab eine Anpassung der Regulierung an die Erfordernisse der Verflechtungen des Monopol- und Finanzkapitals ab. So kann etwa des TTIP Abkommen, welches den Investitionsschutz für transnationale Konzerne vorsieht, den Schutz vor regulatorischen Eingriffen welche Investitionen (auch Finanzinvestitionen) gefährden könnten, als ein Schritt in eine verstärkt international ausgerichtete Regulierung entsprechend der neuen Erfordernisse der Kapitalverwertung, jedoch auch im Interesse der jeweiligen nationalen Monopolkapitale, verstanden werden.
Von Gerfried Tschinkel.
Anmerkungen
(1) Karl Georg Zinn, Krisenerklärung: Drei verlorene Jahrzehnte, In: Elmar Altvater u.a. Krisen Analysen, Hamburg 2009, S. 122
(2) Lukas Zeise, In welchem Kapitalismus leben wir – oder: Der Finanzsektor in der neoliberalen Ausprägung des Stamokap, 2013
(3) Vgl. Lukas Oberndorfer, Marktkonform statt rechtskonform, In: FORUM Wissenschaft, 02.06.2014.